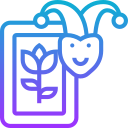This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Gemeinschaftsbasierte urbane Landwirtschaftsinitiativen gewinnen in städtischen Räumen weltweit zunehmend an Bedeutung. Sie bringen Menschen zusammen, stärken Nachbarschaften und bieten innovative Antworten auf aktuelle Herausforderungen wie Lebensmittelversorgung, Klimaanpassung und soziale Integration. In deutschen Städten entstehen immer mehr gemeinschaftlich organisierte Gärten und Landwirtschaftsprojekte, die lokale Lebensmittelsouveränität fördern und soziale Teilhabe ermöglichen. Diese urbanen Gärten geben den Menschen das Gefühl, aktiv zu werden, eigene Lebensmittel anzubauen und gemeinsam nachhaltige Lebensräume zu gestalten. Im Folgenden werden verschiedene Aspekte gemeinschaftsbasierter urbaner Landwirtschaftsinitiativen vorgestellt, ihre Bedeutung für die Gesellschaft hervorgehoben und zukunftsweisende Perspektiven skizziert.
Bedeutung für die städtische Gemeinschaft